Der Durchbruch: Götz von Berlichingen II
Das also soll das Stück sein, das den Ruhm des bedeutendsten
deutschen Dichters begründete:
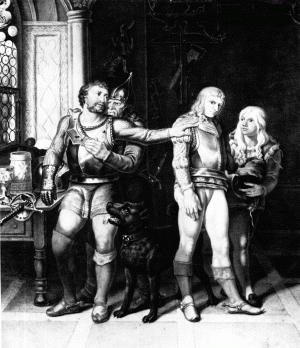 Boie!
Boie! Der Ritter mit der eisernen Hand! Ich weiß mich vor Enthusiasmus
kaum zu lassen. Womit soll ich dem [noch anonymen] Verfasser mein Entzücken
entdecken? Den kann man doch noch den deutschen Shakespeare nennen, wenn
man einen so nennen will.... Welch ein durchaus deutscher Stoff! Welch
kühne Verarbeitung! Edel und frei, wie sein Held, tritt der Verfasser
den elenden Regelnkodex unter die Füße und stellt uns ein ganzes
Evenement, mit Leben und Odem bis in seine kleinsten Adern beseelt, vor
Augen. Erschütterung, wie sie Shakespeare nur immer hervorbringen
kann, habe ich in meinem innersten Mark gefühlt. Mitleid! Schrecken!
- Grausen, kaltes Grausen, wie wenn einen kalter Nordwind anweht! Götzens
kleiner Junge! Die Zigeunerszene, die auf dem Rathause, der sterbende Weislingen,
das heimliche Gericht! Gott! Gott, wie lebendig, wie shakespearisch! O
ich kann selbst nicht sagen, wie vortrefflich! - Glück zu dem edelen
freien Mann, der der Natur gehorsamer als der tyrannischen Kunst war! Mag
doch das Rezensentengeschmeiß, mag doch der Lesepöbel, der die
Nase beim Schnickschnack der Orsina [Lessing, Emilia Galotti] rümpfte,
bei dem A-lecken den Rüssel verziehn! Solches Gesindel mag diesem
Verfasser im - -. O Boie, wissen Sie nicht, wer es ist? Sagen Sie, sagen
Sie mir's, daß ihm meine Ehrfurcht einen Altar baue. Ich behalte
das Stück; will's gerne bezahlen, und wenn es auch noch soviel kostete
und wenn ich alle Werke Voltaires und Corneilles darum verkaufen sollte.
Corneille! - armseliger Bel zu Babel! Wer mag wohl solch leimenem Götzen
Ehre erweisen? Le grand Corneille? Sch-kerl! Sch-kerls alle Franzosen!
Boie!
Boie! Der Ritter mit der eisernen Hand! Ich weiß mich vor Enthusiasmus
kaum zu lassen. Womit soll ich dem [noch anonymen] Verfasser mein Entzücken
entdecken? Den kann man doch noch den deutschen Shakespeare nennen, wenn
man einen so nennen will.... Welch ein durchaus deutscher Stoff! Welch
kühne Verarbeitung! Edel und frei, wie sein Held, tritt der Verfasser
den elenden Regelnkodex unter die Füße und stellt uns ein ganzes
Evenement, mit Leben und Odem bis in seine kleinsten Adern beseelt, vor
Augen. Erschütterung, wie sie Shakespeare nur immer hervorbringen
kann, habe ich in meinem innersten Mark gefühlt. Mitleid! Schrecken!
- Grausen, kaltes Grausen, wie wenn einen kalter Nordwind anweht! Götzens
kleiner Junge! Die Zigeunerszene, die auf dem Rathause, der sterbende Weislingen,
das heimliche Gericht! Gott! Gott, wie lebendig, wie shakespearisch! O
ich kann selbst nicht sagen, wie vortrefflich! - Glück zu dem edelen
freien Mann, der der Natur gehorsamer als der tyrannischen Kunst war! Mag
doch das Rezensentengeschmeiß, mag doch der Lesepöbel, der die
Nase beim Schnickschnack der Orsina [Lessing, Emilia Galotti] rümpfte,
bei dem A-lecken den Rüssel verziehn! Solches Gesindel mag diesem
Verfasser im - -. O Boie, wissen Sie nicht, wer es ist? Sagen Sie, sagen
Sie mir's, daß ihm meine Ehrfurcht einen Altar baue. Ich behalte
das Stück; will's gerne bezahlen, und wenn es auch noch soviel kostete
und wenn ich alle Werke Voltaires und Corneilles darum verkaufen sollte.
Corneille! - armseliger Bel zu Babel! Wer mag wohl solch leimenem Götzen
Ehre erweisen? Le grand Corneille? Sch-kerl! Sch-kerls alle Franzosen!
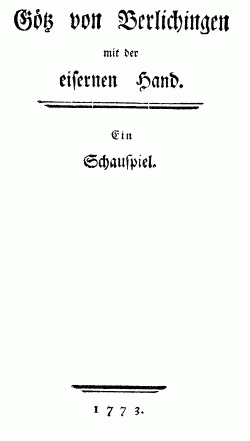 Dieser
Brief Gottfried August Bürgers an Heinrich Christian Boie (8.
7. 1773) ist in all seinen Wendungen typisch für das Echo des Götz
bei der ästhetischen Avantgarde. Als dieses scheinbar unspielbare
Stück dann am 14. April 1774 gar noch erfolgreich in Berlin uraufgeführt
wurde, war der Durchbruch geschafft - der Durchbruch Goethes und des Sturm
und Drang. Um welchen Preis?
Dieser
Brief Gottfried August Bürgers an Heinrich Christian Boie (8.
7. 1773) ist in all seinen Wendungen typisch für das Echo des Götz
bei der ästhetischen Avantgarde. Als dieses scheinbar unspielbare
Stück dann am 14. April 1774 gar noch erfolgreich in Berlin uraufgeführt
wurde, war der Durchbruch geschafft - der Durchbruch Goethes und des Sturm
und Drang. Um welchen Preis?
Gotthold Ephraim Lessing schreibt an seinen Bruder Karl
Gotthelf 30. 4. 1774:
Daß Götz von Berlichingen großen
Beifall in Berlin gefunden, ist, fürchte ich, weder zur Ehre des Verfassers
noch zur Ehre Berlins. Meil [hatte die Kostüme entworfen] hat ohne
Zweifel den größten Teil daran. Denn eine Stadt, die kahlen
Tönen nachläuft, kann auch hübschen Kleidern nachlaufen.
Lessing hat das Problem wohl richtig erkannt. Götz
von Berlichingen wurde tatsächlich zum Vorbild einer Flut von
nationalen Ritterspektakeln und Ausstattungsstücken. Das oben wiedergegebene
Bild von J.F.W. Tischbein entspricht dieser Auffassung, und auch die spätere
Götz-Rezeption
hat daran kaum etwas geändert.
Verloren ging dabei die gehaltliche Tiefendimension: Das
Drama als Spiel von der Grundlegung der modernen Welt. Es wäre an
der Zeit, daß ein Regisseur diese Dimension freilegte.
Homepage | Inhalt
Schlaglichter | Nächste Seite
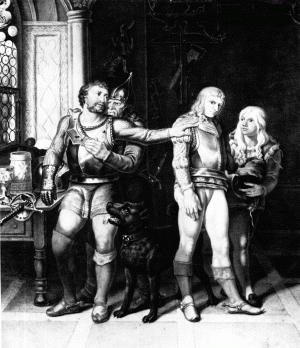 Boie!
Boie! Der Ritter mit der eisernen Hand! Ich weiß mich vor Enthusiasmus
kaum zu lassen. Womit soll ich dem [noch anonymen] Verfasser mein Entzücken
entdecken? Den kann man doch noch den deutschen Shakespeare nennen, wenn
man einen so nennen will.... Welch ein durchaus deutscher Stoff! Welch
kühne Verarbeitung! Edel und frei, wie sein Held, tritt der Verfasser
den elenden Regelnkodex unter die Füße und stellt uns ein ganzes
Evenement, mit Leben und Odem bis in seine kleinsten Adern beseelt, vor
Augen. Erschütterung, wie sie Shakespeare nur immer hervorbringen
kann, habe ich in meinem innersten Mark gefühlt. Mitleid! Schrecken!
- Grausen, kaltes Grausen, wie wenn einen kalter Nordwind anweht! Götzens
kleiner Junge! Die Zigeunerszene, die auf dem Rathause, der sterbende Weislingen,
das heimliche Gericht! Gott! Gott, wie lebendig, wie shakespearisch! O
ich kann selbst nicht sagen, wie vortrefflich! - Glück zu dem edelen
freien Mann, der der Natur gehorsamer als der tyrannischen Kunst war! Mag
doch das Rezensentengeschmeiß, mag doch der Lesepöbel, der die
Nase beim Schnickschnack der Orsina [Lessing, Emilia Galotti] rümpfte,
bei dem A-lecken den Rüssel verziehn! Solches Gesindel mag diesem
Verfasser im - -. O Boie, wissen Sie nicht, wer es ist? Sagen Sie, sagen
Sie mir's, daß ihm meine Ehrfurcht einen Altar baue. Ich behalte
das Stück; will's gerne bezahlen, und wenn es auch noch soviel kostete
und wenn ich alle Werke Voltaires und Corneilles darum verkaufen sollte.
Corneille! - armseliger Bel zu Babel! Wer mag wohl solch leimenem Götzen
Ehre erweisen? Le grand Corneille? Sch-kerl! Sch-kerls alle Franzosen!
Boie!
Boie! Der Ritter mit der eisernen Hand! Ich weiß mich vor Enthusiasmus
kaum zu lassen. Womit soll ich dem [noch anonymen] Verfasser mein Entzücken
entdecken? Den kann man doch noch den deutschen Shakespeare nennen, wenn
man einen so nennen will.... Welch ein durchaus deutscher Stoff! Welch
kühne Verarbeitung! Edel und frei, wie sein Held, tritt der Verfasser
den elenden Regelnkodex unter die Füße und stellt uns ein ganzes
Evenement, mit Leben und Odem bis in seine kleinsten Adern beseelt, vor
Augen. Erschütterung, wie sie Shakespeare nur immer hervorbringen
kann, habe ich in meinem innersten Mark gefühlt. Mitleid! Schrecken!
- Grausen, kaltes Grausen, wie wenn einen kalter Nordwind anweht! Götzens
kleiner Junge! Die Zigeunerszene, die auf dem Rathause, der sterbende Weislingen,
das heimliche Gericht! Gott! Gott, wie lebendig, wie shakespearisch! O
ich kann selbst nicht sagen, wie vortrefflich! - Glück zu dem edelen
freien Mann, der der Natur gehorsamer als der tyrannischen Kunst war! Mag
doch das Rezensentengeschmeiß, mag doch der Lesepöbel, der die
Nase beim Schnickschnack der Orsina [Lessing, Emilia Galotti] rümpfte,
bei dem A-lecken den Rüssel verziehn! Solches Gesindel mag diesem
Verfasser im - -. O Boie, wissen Sie nicht, wer es ist? Sagen Sie, sagen
Sie mir's, daß ihm meine Ehrfurcht einen Altar baue. Ich behalte
das Stück; will's gerne bezahlen, und wenn es auch noch soviel kostete
und wenn ich alle Werke Voltaires und Corneilles darum verkaufen sollte.
Corneille! - armseliger Bel zu Babel! Wer mag wohl solch leimenem Götzen
Ehre erweisen? Le grand Corneille? Sch-kerl! Sch-kerls alle Franzosen!
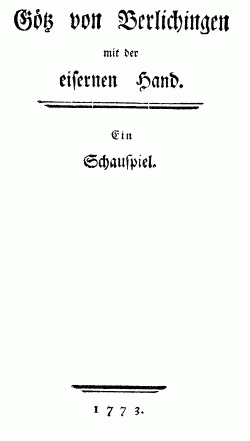 Dieser
Brief Gottfried August Bürgers an Heinrich Christian Boie (8.
7. 1773) ist in all seinen Wendungen typisch für das Echo des Götz
bei der ästhetischen Avantgarde. Als dieses scheinbar unspielbare
Stück dann am 14. April 1774 gar noch erfolgreich in Berlin uraufgeführt
wurde, war der Durchbruch geschafft - der Durchbruch Goethes und des Sturm
und Drang. Um welchen Preis?
Dieser
Brief Gottfried August Bürgers an Heinrich Christian Boie (8.
7. 1773) ist in all seinen Wendungen typisch für das Echo des Götz
bei der ästhetischen Avantgarde. Als dieses scheinbar unspielbare
Stück dann am 14. April 1774 gar noch erfolgreich in Berlin uraufgeführt
wurde, war der Durchbruch geschafft - der Durchbruch Goethes und des Sturm
und Drang. Um welchen Preis?