Rezensionen und Widerworte
|
|
Der junge Goethe in seiner
Zeit
Rezensionen und Widerworte |
Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 279, Dienstag, 1. Dezember 1998, S. L 9
Wanderers Datenbank
Lesen, Clicken, Surfen: „Der junge Goethe in seiner
Zeit“ als Mediensynthese von Buch und CD-ROM / Von Lothar Müller
[…]
Der Welt der Computerspiele kehrt diese CD den Rücken
zu, um alle Kapazitäten auf die "platzsparende Vorratshaltung von
größeren Textmengen" zu verwenden. Diese Aufgabenbestimmung
kommt nicht von ungefähr. Sie ist aus den Leitbegriffen dieser Ausgabe
abgeleitet: "Kontext" und "Intertextualität". Goethe im Kontext -das
bedeutet die Multiplizierung der Textmenge, die Ergänzung seiner Schriften
und Briefe durch die seiner Freunde, Rivalen, Kritiker und Vorbilder. Goethe
intertextuell - das bedeutet die Installierung von Erschließungsprogrammen,
die den Verweisungszusammenhang der vielen Texte untereinander schnell
und erschöpfend sichtbar machen. In der CD-ROM, die den Buchtext entgrenzt,
findet die Philologie im Zeitalter der "Intertextualität" endlich
das ihr angemessene Medium für das "Suchen, Verknüpfen, Nachschlagen
und ,Surfen‘" über die Oberfläche und durch die Tiefen der Universalbibliothek.
Darum stellt die CD nicht nur nach dem Modell der "Materialienbände"
Zusatztexte zu den Werken des jungen Goethe. Sie enthält den gesamten
Buchtext des „Jungen Goethe" noch einmal, um aus einem konservierenden
Archiv zum allseitig aktivierbaren Arbeitsspeicher werden zu können.
[…]
Navigiert man so durch den "Kontext"
des jungen Goethe, wird schnell eine elementare Einschränkung der
nur elektronisch zugänglichen Texte spürbar. Sie sind da und
doch zugleich nicht da. Ihre schnelle Verfügbarkeit ist mit einem
evidenten Verlust an Lesbarkeit erkauft, der überall da hervortritt,
wo es nicht um "Stellen" geht. Wer eine der leicht greifbaren Ausgaben
des "Hofmeister" von Lenz, der Sammlung "Von deutscher Art und Kunst" (1773)
mit Herders ShakespeareEssay, der Quellen zum "Faust" oder der Rezensionen
und Parodien zum "Werther" greifbar hat, wird diese Texte am Bildschirm
kaum lesen wollen. Sie sind, verglichen mit einem gut gemachten Buch, in
einer imaginären B-Ebene angesiedelt, die es wenig attraktiv macht,
sich als Leser längere Zeit in ihr aufzuhalten.
Die elektronische Handbibliothek zum
jungen Goethe ist trotz ihrer riesigen Textmengen gerade nicht als Objekt
extensiver Lektüre, sondern allein als Objekt intensiver Erfassung
und Erschließung nutzbar. Man kann in ihr durch Suchabfragen rasch
alle Einträge zum Stichwort "Prophete" samt "Weltkind" versammeln.
Man kann Suchbereiche erweitern und verengen. Man kann den Weg der Bänder
und Schleifen von der Lyrik des Rokoko bis in die Todesstunde Werthers
systematisch verfolgen. Man kann auch die relative Häufig.keit bestimmter
Begriffe oder Wortkombinationen in Texten untersuchen und die Ergebnisse
dann in eigene Dateien "exportieren". Man kann die Schriften und Briefe
des jungen Goethe strikt chronologisch oder nach Gattungen gegliedert abrufen.
Ihre Stärken als Medium der "Vernetzung" entfaltet die CD-ROM vor
allem auf kleinem Raum. Schnell legt sie einem Klopstocks Gedicht "Das
Rosenband" neben Goethes "Kleine Blumen, kleine Blätter".
Sie erleichtert eher die Synopse im Detail
und die Erstellung oder Nutzung lexikonartiger Einträge als die Erfassung
von Strukturen des großen Ganzen. Darin bleibt dem CD-Benutzer der
Buchleser überlegen. Ist er beides in Personalunion, wird er die B-Ebene
eher meiden, sobald es um Großformen geht.
[…]
Ein Schlüsselsatz im Herausgeberkommentar
dieser Mediensynthese zieht daraus die Konsequenz: "Domäne des Buches
bleibt weiterhin das Lesen im klassischen Sinn." Doch gilt dieses Privileg
im Rahmen dieser Ausgabe eben nur für die Texte des jungen Goethe
selbst. Im übrigen zollt dabei die "Buchkomponente" unverkennbar dem
elektronischen Medium Tribut. Wie die CD-ROM sind die beiden Textbände
als Abzweigung aus dem Textverarbeitungssystem entstanden, das über
Laserausdrucke die Reprovorlagen fürden Druck lieferte. Man sieht
bis in Details von Schrift und Satzspiegel hinein den Büchem diese
Herkunft an. Die kleinen Kreise, die man auf der CD anklickt, um zu den
"Popups" mit Sacherläuterungen zu Namen oder Begriffen zu gelangen,
sind wie Luftblasen über das Schriftbild verstreut. Von
der Unterkante der Seiten steigen fordernd die dazu gehörigen Erklärungen
auf und wollen zugleich mit dem Text wahrgenommen werden. Man muß
kein Anhänger preziöser Buchgestaltung sein, um die Konsequenz
zu bedauern, mit der dieser "junge Goethe" zugunsten der Annäherung
von Leseausgabe und Arbeitsspeicher die bibliophilen Traditionen des Insel
Verlages ausschlägt. [Dazu Widerworte.]
Süddeutsche Zeitung Nr. 284, 9. Dezember 1998, Seite V2/8
Haben Sie alle ihren Goethe
im Schrank?
Am Vorabend des Jubiläumsjahrs: Anmerkungen zu
den angebotenen Ausgaben
[...]
Zum vierten Mal: der junge G.
Eine große Überraschung sind die beiden
Bände Der junge Goethe in seiner Zeit, die Eibl, Jannidis und Willems
konzipiert haben. Seit 1875 gab es schon dreimal Editionen der Schriften
des "Jungen Goethe ", als besonders eng zusammengehörende Zeugnisse
eines extrem intensiven Werdens eines großen Autors; in dieser vierten
Zusammenstellung mit diesem Titel muß man lange suchen, bis man am
Ende des zweiten Bandes ein sehr schlaues, konzises, zwölf Seiten
langes Nachwort der Herausgeber findet, welches das Unternehmen unter geschichtstheoretischen
Gesichtspunkten rechtfertigt, als extrem aussagestarke Zeugnisse einer
Selbstfindung und Selbstmanifestation zu einem historisch höchst wichtigen
Zeitpunkt, das heißt Goethe im "Kontext eines überindividuellen
semantischen Geflechts". Ludwig Tieck faßte das einfacher, ahnte
aber schon was, als er auf die Frage, wer der größte deutsche
Autor sei, antwortete: der junge Goethe, ehe er Frankfurt verließ.
Da nun aber der "Kontext eines überindividuellen semantischen Geflechts"
bei dieser Ausgabe hauptsächlich durch die Daten und Bilder und Textzeugen
auf einer CD-Rom geboten wird, muß ich erst einmal diese CD-Rom abzufragen
lernen.
[...]
Jörg Drews
DIE ZEIT , 26. August1999 Nr. 35 S. 40
86-mal Technik
Goethe auf CD-Rom: Das ideale Medium, nicht zum Lesen,
aber zum Recherchieren VON TOBIAS GOHLIS
[…]
Während diese CD-ROM-Ausgaben [Directmedia, Chadwyk-Healey]
die ungeheuren Speicherkapazitäten des Mediums nutzen - Chadwyck hat
65 000 Seiten Text erfasst, die nach einem etwas schleppenden Programm-Start
in Sekundenschnelle durchsucht werden können — geht der Insel Verlag
einen anderen, zukunftsträchtigen Weg. Seine Ausgabe beschränkt
sich auf Goethes bis 1775 entstandene Arbeiten (darunter der Götz,
Clavigo, Urfaust, Werther, Gedichte, Briefe, Juristische Schriften). Diese
werden dem Leser — hier ist besonders an junge Enthusiasten zu denken;
gelobt sei jede Schule, die den Jungen Goethe statt des obligatorischen
Duden als Jahresprämie vergibt — doppelt ausgehändigt: als Buch
zum Lesen und als CD-ROM zürn Recherchieren. Wobei die elektronische
Hypertext-Umgebung all das enthält, was des Lesers Herz oben entbehrte:
einen durchgängigen Wort-für-Wort-Kommentar, der sich unmittelbar
aus dem Text durch herausklappbare Pop-up-Menüs erschließt und
mit allen Raffinessen durchsuchbar ist, Zeichnungen des jungen Multitalents
und vor allem: zeitgenössisches Material. Das, woraus die Kommentatoren
der Buchausgaben schöpfen, ist hier verschwenderisch an die Maushand
gegeben. Ein Bestandskatalog der elterlichen Bibliothek gibt Auskunft,
was der Kleine, der bereits mit sechs Jahren Gediche Sprachen in Wort und
Schrift benutzte, gelesen haben mag. Luthers Bibel, eine der Haupt-quellen
des Sturm und Drang, ist zu großen Teilen im gemäßigten
Luther-Deutsch von 1912, die Genesis aber auch in Luthers Original (1545)
und einer zeitgenössischen Version (1782) enthalten. Hederichs Mythologisches
Lexikon erschließt Goethes Götterhimmel. Auch wenn das Herausgebertrio
mit Bezeichnungen wie „Labores Juvcniles" die Schulaufgaben, die auch Genies
einmal machen mussten, etwas überhöht - im Frühwerk selbst
wird doch deutlich, dass der Junge sich nicht nur in Anakreontik und Bukolik
übte, sondern auch eine ganz deftige Pubertät mit allen dazugehörigen
Ergüssen durchmachte. Mit 88 Mark für zwei Taschenbuchbände
samt CD-ROM ein wahres Geschenk zum Goethe-Jahr.
[…]
Süddeutsche Zeitung Nr. 198, 28./29. August 1999, S. V.
CD-Rom im Test
Goethe auf Vorrat
[…]
Der Münchner Germanistikprofessor Dr. Karl Eibl
ist ein Pionier literaturwissenschaftlicher Erschließung des Mediums
CD-Rom. Vor sieben Jahren edierte er im Rowohlt Verlag den Nachlass von
Robert Musil, nun legt er das Frühwerk Goethes in einer Hybrid-Ausgabe
als Buch und CD-Rom vor. Das Ergebnis ist eine mustergültige Edition,
die mit zwei dicken Bänden zum „Lesen im klassischen Sinn" einlädt
und zugleich das Frühwerk Goethes samt einer immensen Fülle an
Zeitzeugnissen elektronisch erschließt. Auf eine besonders ansprechende
Aufbereitung der Datenfülle wurde verzichtet, doch ist alles übersichtlich
und funktional gestaltet. Ein Mausklick auf „Der junge Goethe" führt
zum nach Gattungen geordneten Werk, zu Briefen, „Juristischem", Zeichnungen.
„Überarbeitungen" und „Erinnerungen" Goethes ergänzen drei Hauptmenüs
mit Sekundärliteratur: „Kontexte", „Semantische Vorräte" (von
der Bibel bis zur Bibliothek der Eltern) und „Erschließungshilfen"
(Glossar, Indices, Bibliographie). Für interessierte Laien erläutern
Hypertextverknüpfungen Wörter und Begriffe.
Das Softwareprogramm Folio Views hat
es also möglich gemacht: die „intertextuelle Einbettung" des jungen
Goethe in seine Zeit - Sturm und Drang auf CD-Rom, für Profis wie
für Liebhaber.
Michael Bauer
Zu Lothar Müller
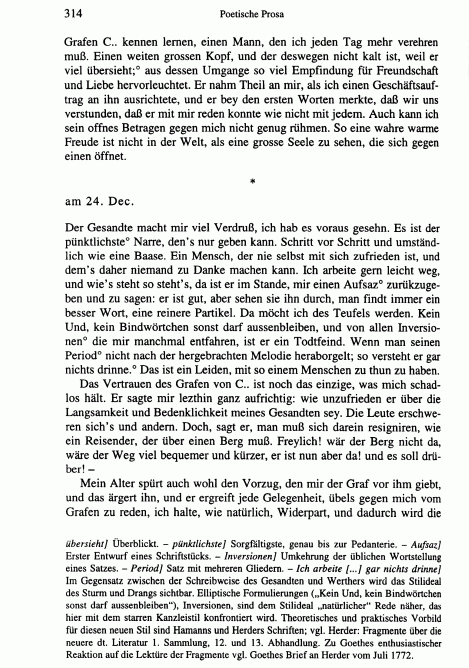 Von
der Unterkante der Seiten steigen fordernd die dazu gehörigen Erklärungen
auf und wollen zugleich mit dem Text wahrgenommen werden,
formuliert Lothar Müller. An anderer Stelle
(Lederpapier. Zeitschrift der Erlanger Buchwissenschaft 23, Juli 1999,
S. 33-35) heißt es in seltsamem Gleichklang: Die entsprechenden
Erklärungen steigen von der Unterkante der Seiten auf und wollen zugleich
mit dem Text wahrgenommen werden. Was ist das, was da so bedrohlich
fordernd aufsteigt als wäre es Godzilla? Es sind Fußnoten! Sie
ergeben sich aus der Hybrid- Konstruktion: Das Buch zum Lesen, die CD zu
Surfen und Nachschlagen, und zwar konsequent. Für das Lesen
in der Buchkomponente erschien es uns sinnvoll, nach dem Vorbild des alten
Heinrich Düntzer und vieler anderer Gelehrter aus dem 19. Jahrhundert
die Einzelerläuterungen an den Fuß der Seite zu setzen. Die
Elektronik hätte genausogut den üblichen Anhang- Kommentar hergegeben,
den bekannten Wald, in dem man sich ständig verirrt und den man deshalb
meidet. Die Erklärungen wollen wahrgenommen werden; so ist es.
Von
der Unterkante der Seiten steigen fordernd die dazu gehörigen Erklärungen
auf und wollen zugleich mit dem Text wahrgenommen werden,
formuliert Lothar Müller. An anderer Stelle
(Lederpapier. Zeitschrift der Erlanger Buchwissenschaft 23, Juli 1999,
S. 33-35) heißt es in seltsamem Gleichklang: Die entsprechenden
Erklärungen steigen von der Unterkante der Seiten auf und wollen zugleich
mit dem Text wahrgenommen werden. Was ist das, was da so bedrohlich
fordernd aufsteigt als wäre es Godzilla? Es sind Fußnoten! Sie
ergeben sich aus der Hybrid- Konstruktion: Das Buch zum Lesen, die CD zu
Surfen und Nachschlagen, und zwar konsequent. Für das Lesen
in der Buchkomponente erschien es uns sinnvoll, nach dem Vorbild des alten
Heinrich Düntzer und vieler anderer Gelehrter aus dem 19. Jahrhundert
die Einzelerläuterungen an den Fuß der Seite zu setzen. Die
Elektronik hätte genausogut den üblichen Anhang- Kommentar hergegeben,
den bekannten Wald, in dem man sich ständig verirrt und den man deshalb
meidet. Die Erklärungen wollen wahrgenommen werden; so ist es.